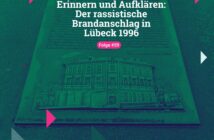In seinen beiden Oktober-Sitzungen machte der Untersuchungsausschuss NSU/Rechter Terror im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern die Kontinuitäten von rechtsterroristischen Netzwerken zum Thema: Er widmete sich Combat18 (C18), dem Aktionsbüro Süd/Kameradschaft Süd rund um Martin Wiese sowie der Oldschool Society (OSS). Wenn es um C18 und die Kameradschaft Süd geht, geht es immer auch um den NSU-Komplex. Beide Strukturen waren während der politischen Sozialisation des NSU und während der Mordserie und darüber hinaus aktiv und hatten Einfluss auf Mitglieder des NSU-Netzwerks. In der Beweiserhebung des Ausschusses wurde einmal mehr deutlich, dass es sich bei beiden Gruppen um Strukturen mit niedrigschwelligem Zugang zu Waffen handelte.
Über C18 berichteten am 13. Oktober eine Zeugin von der Bundesanwaltschaft und ein Zeuge vom LKA Mecklenburg-Vorpommern. Beide gingen auf die im Vereinigten Königreich beginnende Geschichte von C18 als militantem Arm von Blood & Honour (B&H) ein. In Deutschland wurde B&H im Jahr 2000 verboten, C18 jedoch nicht. Die deutschen Gruppen spielten eine große und immer noch nicht ausermittelte Rolle als Unterstützungsstruktur für den NSU. Das Kerntrio und sein Umfeld hatten sich in den Jahren vor dem Untertauchen auch auf von Blood & Honour organisierten Konzerten bundesweit vernetzt.
Nur wenige Monate nach der Selbstenttarnung des NSU fand 2012 eine statt, die von der Antifa-Recherche-Plattform Exif Recherche aufgedeckt wurde. Erst im Januar 2020 wurde das Netzwerk verboten. In den Befragungen wurde deutlich, dass Erkenntnisse und die Veröffentlichung von Exif auch für das Verbot relevant waren. Zwei Jahre später fanden Durchsuchungen statt, weil das Verbot missachtet worden war. Der GBA erhob Anklage gegen die als Rädelsführer ausgemachten Stanley Röske, Keven Langner, Robin Schmiemann und Gregor Michels, die nach dem Verbot Tonträger produziert und Konzerte und Treffen organisiert haben sollen. Verfahren gegen andere Beschuldigte gab der GBA an Staatsanwaltschaften in verschiedenen Bundesländern ab, auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Seit Juni diesen Jahres läuft der Prozess vor dem Landgericht Dortmund (wir berichteten in unserem August-Newsletter).
Die Zeugin des GBA berichtete im Ausschuss, dass sie eigentlich Anklage vor dem OLG Düsseldorf erhoben hätten. Dieses habe das Verfahren aber nicht vor einem Staatsschutzsenat eröffnet, weil es im Gegensatz zum GBA die besondere Bedeutung der Gruppe und die „Strahlkraft von C18“ nicht gesehen habe. Das habe man so hingenommen, so die Zeugin, trotzdem würden die einzelnen Personen strafrechtlich verfolgt.
Über Martin Wiese und seine Strukturen berichtete am 27. Oktober der Sachverständige Robert Andreasch vom a.i.d.a.-Archiv in München. Wiese war 2003 festgenommen und später verurteilt worden, weil er am 9. November 2003 einen Anschlag auf die Grundsteinlegung der Münchener Synagoge geplant hatte. Andreasch beschrieb eindrücklich die Zuspitzung des Organisationationsgrades und der Gewalt in der Münchener Neonazi-Szene in den späten 1990er- und frühen 2000er-Jahren.
Mit dem Aktionsbüro Süd war eine Struktur mit „Magnetwirkung“ geschaffen worden, so Andreasch, in der Wiese nach seinem Zuzug aus Mecklenburg-Vorpommern schnell eine Führungsrolle übernahm. Die Mitglieder der Struktur teilten sich in Untergruppen auf, was dazu führte, dass an jedem Tag in der Woche einige neonazistisch aktiv sein konnten. Wiese selbst war Teil der „Schutzgruppe“ des Aktionsbüro Süd. Man trainierte aber nicht nur, um eigene Treffen oder Demonstrationen zu schützen, sondern machte auch Schießtrainings und sogenannte Wehrsportübungen. Schnell ging die „Schutzgruppe“ dazu über, Waffen und Sprengstoff zu besorgen. Angestachelt wurden die Mitglieder der Gruppe auch durch einen Geheimagenten des bayerischen Verfassungsschutzes, der die Gruppe nicht nur zu einer Waffenübergabe nach Güstrow nahe Rostock fuhr, sondern die Struktur auch dazu anhielt, mehr Anti-Antifa-Arbeit zu machen.
Diese Entwicklung erinnert an die Sozialisation des NSU-Kerntrios in der Kameradschaft Jena und dem Thüringer Heimatschutz. Andreasch sagte im Ausschuss, man wisse nicht von direkten Verbindungen von Wiese zum NSU, aber zum einen sei es nicht weit zu Neonazis, die immer wieder Gegenstand von Recherchen zum Unterstützungsnetzwerk seien. Zum anderen wurde klar, dass sich deutschlandweit Neonazis in Kameradschaftsstrukturen organisierten, vernetzten und aktiv waren und gleichzeitig rechtsterroristische Taten planten oder sogar durchführten.
Auch nach seiner Verurteilung blieb Wiese aktiv. Er meldete sich aus dem Gefängnis und war direkt nach seiner Haftentlassung auch wieder auf Veranstaltungen unterwegs. Neben anderen Neonazis steht Wiese für eine Kontinuität des rechten Terrors seit Ende der 90er-Jahre. 2020 wurde er auf Querdenken-Aufmärschen in Berlin gesehen und zuletzt unterstützte er einen langjährigen Kameraden vor Gericht. Diesmal in Mecklenburg-Vorpommern, wo er inzwischen wieder wohnhaft ist.
Andreasch machte auch darauf aufmerksam, dass Neonazis in ihren rechtsterroristischen Bestrebungen aufeinander Bezug nehmen und voneinander lernen – mit oder ohne direktes Kennverhältnis. Dies gilt auch für die OSS, die davon träumte, den NSU wie einen „Kindergarten“ aussehen zu lassen, bevor sie von den Behörden gestoppt werden konnten.
Der Untersuchungsausschuss tagt in diesem Jahr noch am 17. und 24. November sowie am 1. Dezember.
Dieser Kurzbericht erschien zuerst in unserem monatlichen Newsletter „Aufklären und Einmischen“. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben? Hier den Newsletter abonnieren!
(Text:ck, Redaktion: scs)