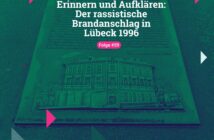Antifaschistische Kundgebung zur letzten öffentlichen Sitzung des Neukölln-Untersuchungsausschusses am 4. Juli 2025
Öffentliche Sitzungen des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex im Berliner Abgeordnetenhaus finden nicht mehr statt. Stattdessen berät der Ausschuss nun in nicht-öffentlichen Sitzungen darüber, was in seinem Abschlussbericht stehen soll.
(Erweiterte Version eines Textes aus unserem monatlichen Newsletter, „„Aufklären & Einmischen“, den ihr hier abonnieren könnt.)
Der Abschlussbericht des Ausschusses muss unter anderem dessen faktische Feststellungen zum Untersuchungsgegenstand sowie Schlussfolgerungen und Empfehlungen enthalten. Der Bericht wird danach dem gesamten Plenum des Abgeordnetenhauses zur Entscheidung vorgelegt. Den Teil zu den Feststellungen entwirft zunächst das (unparteiische) Ausschussbüro. Nach Informationen aus dem Ausschuss liegt den Mitgliedern bereits ein Entwurf für das Kapitel zu den Feststellungen vor, über das der Ausschuss nun beraten muss. Erst danach wird es um Schlussfolgerungen und Empfehlungen gehen, also um die politische Bewertung des Behördenhandelns und die aus Sicht des Ausschusses notwendigen Konsequenzen.
Die Bedeutung des faktischen Teils des Berichtes sollte nicht unterschätzt werden. Es ist wichtig, dass relevante Ergebnisse der Beweiserhebung dort, also jenseits der – immer strittigen – politischen Bewertung, auch tatsächlich benannt und so parlamentarisch festgestellt werden. Hier kommt es also darauf an, welche Aussagen und anderen Beweismittel im Bericht Erwähnung finden. Gespannt kann man zum Beispiel sein, ob und in welchem Umfang auch Aussagen auftauchen, die in nicht-öffentlicher Sitzung getätigt wurden. Der Ausschuss müsste – zumindest bei höheren Geheimhaltungsgraden – bei der jeweiligen Behörde darauf hinwirken, dass diese den vergebenen Geheimhaltungsgrad herabstuft, so dass es sich nicht mehr um eine Verschlusssache handelt. Gleiches gilt auch für eingestufte Dokumente, denn auch diese können zum Teil des Berichtes werden.
Insbesondere der Berliner Verfassungsschutz, die Abteilung 2 der Senatsverwaltung für Inneres, hatte sich im Ausschuss zugeknöpft gezeigt. Die meisten Aussagen der Geheimdienstler*innen fanden in geheimer Sitzung statt, viele sogar in Räumlichkeiten der Senatsverwaltung, nicht im Abgeordnetenhaus. Im Unterschied zu Vernehmungen von Polizeibeamt*innen, die lediglich teilweise nicht-öffentlich waren, fanden die meisten Beweiserhebungen zum Verfassungsschutz also unter komplettem Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Viele Betroffene stellen sich aber die Frage, was der Verfassungsschutz eigentlich dafür getan hat, dass sie nicht zum Opfer von Brandstiftungen, Bedrohungen und Anschlägen werden, ob bei dem Inlandsgeheimdienst noch immer Quellenschutz vor Opferschutz geht.
Von Bedeutung wird auch sein, was der Ausschuss in seinem Bericht zu den Ermittlungen bei den Mordfällen Burak Bektaş und Luke Holland feststellt. Wird im Bericht zum Beispiel festgehalten, was die Beweiserhebung des Ausschusses ergeben hat – nämlich, dass die Ermittlungen zum Mord an Burak Bektaş keineswegs so umfassend und intensiv geführt wurden, wie die Polizei stets behauptete? Nur ein Beispiel: Der Name des Mörders von Luke Holland taucht bereits in den Akten zum Mord an Burak Bektaş auf, der Hinweis wurde jedoch weitgehend ignoriert. Auch dies wurde im Rahmen der Beweiserhebung des Ausschusses noch einmal klar. Beim Mord an Luke Holland wiederum konnte der Ausschuss zudem feststellen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft vorhandene Hinweise auf eine rechte Motivation des Täters bestenfalls nachlässig behandelt hatten.
Philip Holland, Vater von Luke Holland, hatte im Rahmen seines Statements im Ausschuss darauf hingewiesen, dass der Mord an seinem Sohn und der Mord an Burak Bektaş sich viel ähnlicher seien, als es bei der Polizei den Anschein gemacht habe. Ein Radiomoderator, mit dem er gesprochen habe, habe mehr darüber herausgefunden, was beim Mord an Burak Bektaş passiert ist, als die Polizei; das sei ihm als „geradezu lachhaft“ erschienen, so Philip Holland. (Bericht von der 31. Sitzung)
Das Statement von Philip Holland gehört ebenfalls in den Abschlussbericht. Überhaupt müssen die Betroffenen ausreichend Raum im Abschlussbericht bekommen. Ihre Zeug*innenaussagen liegen meist bereits mehrere Jahre zurück und verdienen es noch einmal angemessen dargestellt zu werden. Erste Zeugin im Ausschuss war Claudia von Gélieu. Auf ihr Fahrzeug wurde im Februar 2017 ein Brandanschlag verübt. Ins Visier von Neonazis geraten war sie wegen ihres jahrzehntelangen antifaschistischen Engagements, unter anderem in der Galerie Olga Benario in Neukölln. Sie gehört zu den Aktiven und Betroffenen, aufgrund deren Engagements es überhaupt erst zum Neukölln-Untersuchungsausschuss kam. Claudia von Gélieu sagte in der dritten Sitzung des Ausschusses, am 2. September 2022, aus (Bericht von der 3. Sitzung). Seitdem beobachtete sie so regelmäßig wie kaum jemand anderes den Ausschuss und äußert sich öffentlich zu dessen Arbeit.
Gegenüber NSU-Watch sagt Claudia von Gélieu nun zu ihren Erwartungen an den Abschlussbericht: „Wie sich die Sicherheitsbehörden der parlamentarischen Kontrolle entzogen haben, muss an erster Stelle im Abschlussbericht stehen. Er muss Vorschläge für wirksame demokratische Kontrollstrukturen entwickeln.“ Für sie gehört zur Frage nach einer wirksamen Kontrolle der Behörden auch, dass der Öffentlichkeit die Wortprotokolle des Untersuchungsausschusses zugänglich gemacht werden.
Claudia von Gélieu weiter: „Festzuhalten ist, dass ein unkontrollierbares System nicht mit weiteren rechtlichen, personellen und technischen Möglichkeiten ausgestattet werden darf, sondern alles, was sich nicht kontrollieren lässt, abgeschafft wird.“ Dass der gemeinsame Abschlussbericht diese Schlussfolgerung teilen wird, ist unwahrscheinlich. Im Anschluss an den gemeinsamen Teil wird es wahrscheinlich mindestens ein sogenanntes Sondervotum aus den Reihen der Opposition geben. In Sondervoten können Fraktionen ihre vom Bericht abweichenden Schlussfolgerungen darstellen. Vielleicht findet sich ja dort eine ähnliche Einschätzung.
Wann der Bericht im Plenum zur Abstimmung stehen wird, ist noch unklar. Es wird aber vermutlich erst im zweiten Quartal 2026 so weit sein.
(Text: scs; Redaktion: ck)