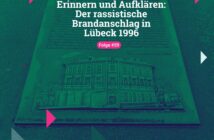Am Vormittag des 2. Verhandlungstags im 2. NSU-Prozess sagen drei Ermittler zu einer Krankenkassenkarte aus, die Susann Eminger Beate Zschäpe überlassen haben soll. Am Nachmittag wird der Leiter der gesamten Ermittlungen im NSU-Verfahren vernommen. Er berichtet von gründlichen Ermittlungen, was im Widerspruch steht zu milden Urteilen, Ermittlungs-Einstellungen und dem späten 2. NSU-Prozess.
Zeugen:
- Jürgen H., Kriminalhauptkommissar (KHK) (Krankenkassenkarte von Susann Eminger)
- Sven G., KHK beim BKA (Krankenkassenkarte von Susann Eminger und Befragung von Zahnärzten)
- Torsten Sch., 1. KHK (Krankenkassenkarte von Susann Eminger)
- Frank Leibnitz, KHK (Ermittlungsleiter BKA)
Bevor der erste Zeuge aufgerufen wird, sagt die Vorsitzende Richterin Simone Herberger, dass sie am 21. November das Bekenntnisvideo des NSU in Augenschein nehmen und einen Mitarbeiter des BKA zur Historie befragen wolle.
Zu Beginn werden drei Polizeibeamte, die im Rahmen der Ermittlungen nach der Selbstenttarnung des NSU zur Krankenkassenkarte von Susann Eminger ermittelt haben. Erster Zeuge ist KHK Jürgen H., der für die Ermittlungen zum Bundeskriminalamt (BKA) abgeordnet war. H. hatte den Auftrag, die Krankenkassendaten der Emingers auszuwerten. Für die Anforderung der Daten hatte es einen richterlichen Beschluss gebraucht. Er berichtet, dass sie die Daten der Eheleute Eminger bei der Krankenkasse „IKK classic Dresden“ von 2007 bis 2011 gehabt hätten. Im dritten und vierten Quartal 2009 habe es, so H., Besuche bei zwei verschiedenen Zahnärzten auf die Karte von Susann Eminger gegeben. Eine Spezialisierung der Ärzte sei nicht erkennbar gewesen. An weiteren Ermittlungen hat H. nicht teilgenommen, er gibt auf weitere Fragen der Vorsitzenden an, kaum noch Erinnerungen an die Ermittlungen zu haben.
Der dann folgende Zeuge Sven G., KHK beim BKA sagt, er sei Teil des Teams in der „Besonderen Aufbauorganisation“ (BAO Trio) gewesen, das sich mit den Beschuldigten André und Susann Eminger beschäftigte. Er sei im Juni 2012 mit Kollegen nach Zwickau gefahren und habe relevante Ärzte aufgesucht. Im System des Zahnarztes M. sei eine Susann Eminger als Patientin vermerkt gewesen, an die sich M. aber nicht habe erinnern könne. Auch eine Wahllichtbildvorlage habe bei M. nicht weitergeholfen. Zwei Arzthelferinnen hätten auf den vorgelegten Bildern aber Beate Zschäpe als Patientin wiedererkannt. Zschäpe sei unter ihrem richtigen Namen jedoch nicht verzeichnet gewesen. In der folgenden Befragung erst durch die Vorsitzende, dann auch durch die Verteidigung geht es unter anderem darum, dass M. bei der Einvernahme bereit gewesen sei auszusagen – das sei auch dokumentiert worden, so G. –, dass er aber, als sie später den Zahnstatus angefordert hätten, auf seine ärztliche Schweigepflicht verwiesen habe. Ein richterlicher Beschluss, um auch den Zahnstatus zu bekommen, wurde dann offenbar nicht beantragt. Ausführlicher geht es in der Befragung auch um die damals gemachten sogenannten sequentiellen Wahllichtbildvorlagen, die in Schwarz-Weiß-Kopien auch über den Bildschirm im Gerichtssaal in Augenschein genommen werden. Pro beschuldigter Person gab es eine Bildreihe aus Einzelbildern von sieben Frauen sowie jeweils ein Bild von Beate Zschäpe und von Susann Eminger, die den Zeug*innen dann nacheinander vorgelegt wurden. Die Verteidigung stellte hierzu und generell zur Befragung der Arzthelferinnen und deren Belehrung Detailnachfragen.
Als dritter Zeuge sagt dann Torsten Sch., Erster Kriminalhauptkommissar aus. Sch. sagt, er sei im „Team Beate Zschäpe“ gewesen und damit beauftragt, verschiedene Ärzte aufzusuchen, um Wahllichtbildvorlagen zu machen. Er habe zwei HNO-Ärzte, eine Zahnärztin und zwei Allgemeinmediziner befragt. Die beiden HNO-Ärzte und die Zahnärztin hätten Susann Eminger als Patientin erkannt, eine der Allgemeinmedizinerinnen habe keine Person und eine habe Mundlos erkannt. Letztere habe Mundlos sehr plastisch vor Augen gehabt, habe sich auch daran erinnert, welchen Beruf er angegeben habe. In den dazugehörigen Unterlagen hätten Größe und Gewicht gestanden und als Beruf „Kraftfahrer“ gestanden. Auch Sch. kann sich nicht mehr detailliert erinnern, hat sich aber anhand der Akten auf die Vernehmung vorbereitet. Auch diesen Zeugen befragt die Verteidigung zum Thema sequentielle Wahllichtbildvorlage.
Nach der Mittagspause betritt der vierte Zeuge des Tages den Saal: Frank Leibnitz vom BKA. Die Vorsitzende Richterin sagt zur Begrüßung, es werde viele Fragen an den Zeugen geben, auch zu den einzelnen Taten. Man wolle aber zunächst einen Überblick zu den Ermittlungen im NSU-Komplex, zum Trio aber auch zu den Emingers bekommen. Das Verfahren habe eine ganze Zeit geruht und sie wolle das gern dargestellt bekommen. Man habe vereinbart, dass der Zeuge nach der Aussage von Zschäpe noch einmal geladen werde. Leibnitz: „Für Sie ist das eine lange Zeit, für mich ist das Alltag.“ Leibnitz berichtet, er sei am 11. November 2011 mit den Verfahren betraut worden, er habe unterschiedliche Funktionen gehabt, heute sei er Leiter des Gesamtverfahrens zum NSU.
Leibnitz beginnt seinen Bericht mit dem 4. November 2011, dem Tag der Selbstenttarnung des NSU und wie die Polizei Thüringen durch Ermittlungen und „sicher auch ein bisschen Glück“ das Wohnmobil der Täter gefunden habe. Nachdem Polizeibeamte sich genähert hätten, seien Schüsse gefallen, dann habe das Wohnmobil gebrannt, schließlich habe man zwei Leichen gefunden. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass es sich lediglich um einen Banküberfall handelt. Drei Stunden später habe es aber in Zwickau eine Explosion gegeben. Man habe das erst nicht zusammengebracht, aber dann habe ein Bürger gemeldet, dass er das Wohnmobil, das im MDR gezeigt worden war, zuvor in der Zwickauer Frühlingsstraße gesehen habe. Es habe dann eine Woche gedauert, bis die Bundesanwaltschaft (BAW) das Verfahren übernommen habe. Bei den Ermittlungen in dieser Woche seien sie als BKA aber schon präsent gewesen. Ausschlaggebend seien die im Wohnmobil gefundenen Waffen von Michèle Kiesewetter und Martin A. und der Fund der Česká CZ 83 in der Frühlingsstraße gewesen. Die Waffe setzte der NSU bei allen Taten der rassistischen Mordserie ein.
Er selbst habe auch die Erstauswertung der NSU-Bekenner-DVD vorgenommen, so Leibnitz. Die BAW habe am 11. November das Verfahren endgültig übernommen, weil sich auf dieser DVD eine terroristische Vereinigung zu Morden und zwei Sprengstoffanschlägen bekennt. Leibnitz nennt dann die vier Ermittlungsgruppen, die es damals zu dem Thema gab: die „Soko Capron“ zu der Raubüberfallserie, die „BAO Frühling“ zur Explosion in der Frühlingsstraße, die „Soko Parkplatz“ zum Mord in Heilbronn und die „Soko Bosporus“ (die seit 2005 bestehende Ermittlungsgruppe zur Mordserie, bei der die Česká eingesetzt wurde). Das Verfahren der BAW sei erst gegen Zschäpe geführt worden, am 12. November sei Holger Gerlach ins Verfahren übernommen worden, drei Tage später André Eminger, einen Tag später Ralf Wohlleben, dann drei weitere Beschuldigte. Leibnitz: „Es waren sehr intensive Ermittlungen mit viel Personal und 24/7 Schichtdienst“, eine „Mammutaufgabe“. Insgesamt hätten 14 Personen im Fokus gestanden, Mitglieder oder Unterstützer gewesen zu sein. Susann Eminger sei am 10. Januar 2012 ins Verfahren gekommen.
„Ein Jahr nachdem der NSU sich selbst enttarnt hat“, im November 2012, habe die BAW dann die Anklage in München erhoben. Am 13. November 2012 sei das Verfahren gegen Susann Eminger abgetrennt worden. Das Verfahren gegen Unbekannt (sogenanntes Strukturermittlungsverfahren) laufe bis heute, so Leibnitz, das sei seine tägliche Arbeit.
Vorsitzende Richterin Herberger sagt, den Blick auf das Verfahren in München wolle sie zurückstellen und sich zunächst auf Susann Eminger konzentrieren. Der Zeuge führt aus, der Anfangsverdacht gegen Eminger habe aus der Durchsuchung resultiert, die eigentlich André Eminger gegolten habe. Bei der Auswertung der Mobiltelefone habe man einen SMS-Verkehr zwischen Susann und André Eminger festgestellt, in dem Susann Eminger berichtet, dass sie mit „Lise und Gerry“ (Spitznamen der Aliasse von Zschäpe und Böhnhardt) unterwegs sei. André Eminger habe zu der Zeit im Krankenhaus gelegen. Man habe, so Leibnitz weiter, auch Bahncards auf den Namen von Susann Eminger, aber mit dem Lichtbild von Zschäpe gefunden. Es gebe insgesamt mehrere Sachverhalte, bei denen Eminger Zschäpe ihre Personalien zu Verfügung gestellt habe. Herberger fordert den Zeugen auf, die Verdachtsgründe gegen Susann Eminger zum Zeitpunkt der Abtrennung des Verfahrens zusammenzufassen. Der Zeuge antwortet, man habe festgestellt, dass die Krankenkassenkarte der „IKK classic Dresden“ für mindestens fünf Zahnarzttermine zur Verfügung gestellt worden sei. Außerdem nennt er die Bahncards sowie die Fahrt von Susann Eminger mit Zschäpe und Böhnhardt nach Schreiersgrün zur Abholung des für den Banküberfall am 4. November angemieteten Wohnmobils.
Herberger hält vor, dass sich laut Akte die Erkenntnisse zum Verhältnis von Zschäpe und Susann Eminger schon relativ früh im Jahr 2012 verdichtet hätten. Leibnitz sagt, es seien über 7.000 Asservate ausgewertet worden und dabei hätten sich immer wieder Aspekte zu Susann Eminger gefunden, zum Beispiel Hinweise, dass sie in der Wohnung in der Frühlingsstraße ein- und ausgegangen sei. Die Wohnung sei mit Videokameras gesichert gewesen, einzelne Aufnahmen seien noch da gewesen. Nachbarn aus der Polenzstraße und der Frühlingsstraße hätten Susann Eminger wiedererkannt, Eminger habe sich als Schwester von Zschäpe vorgestellt. Leibnitz geht auf die Buchung einer Reise ins Disneyland für Emingers ein und sagt dann: „Da gab es dann so viele Dinge, dass man sagen konnte, es gibt ein relativ klares Bild.“
Zum Kennenlernen von Susann Eminger und Beate Zschäpe sagt der Zeuge, dass Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe André Eminger schon früh kennengelernt hätten. André Eminger habe die Drei in der Anfangsphase sehr unterstützt, sei sicherlich am Anfang einer der ersten und wichtigsten Helfer gewesen. Direkt in Chemnitz habe es noch andere Unterstützer gegeben, aber spätestens mit dem Umzug nach Zwickau sei André Eminger der zentrale Ansprechpartner gewesen, „jemand, der Türen öffnen konnte“. Er habe zum Beispiel Matthias D. „angeschleppt und überredet, Personalien für die Wohnungen zu geben“. Es sei tatsächlich auch eine Freundschaft zu André Eminger gewesen. Susann Eminger sei wohl erst im Jahr 2000 in das Leben von André Eminger getreten. Es sei verwunderlich, so Leibnitz, dass es dann sehr lange gedauert habe, bis die Drei und Susann Eminger sich kennengelernt hätten. Er selbst würde das auf die Zeit nach der Geburt des zweiten Eminger-Sohnes terminieren. Zschäpe habe dazu bei ihren Vernehmungen vor zwei Jahren gesagt, es habe unangenehme Erfahrungen mit Partnern von Unterstützern gegeben, beispielsweise hätten sich Mandy St. und Max-Florian Bu. unfriedlich getrennt. Daher habe man Vorbehalte gegen Partner von Unterstützern gehabt, falls es zur Trennung komme.
Leibnitz sagt, er finde es plausibel, dass man das persönliche Kennenlernen weiter auf die Zeit nach dem Vorfall am 7. Dezember 2006 eingrenzen könne. Damals habe es in der Polenzstraße einen Hausfriedensbruch mit Wasserschaden gegeben; jemand habe den Wasserhahn aufgedreht und das Wasser sei nach unten gelaufen. Die Polizei habe später vor Ort ermittelt und auch an der Wohnung, in der „Zschäpe mit den beiden Jungs“ wohnte, geklingelt. Leibnitz: „Das war, wie ich finde, ein wichtiger Punkt in der Zeit des Untertauchens, das hätte dazu führen könne, dass das Gefüge enttarnt wird von einem auf den anderen Tag.“ Zschäpe habe die Personalien von Susann Eminger angegeben, weil sie fand, man habe sich ähnlich gesehen. Zschäpe hatte laut Leibnitz vorher Bilder von Susann Eminger gesehen. Wegen dieser Angabe an der Wohnungstür habe es dann eine schriftliche Ladung gegeben an die Adresse der Emingers. Der Ladung sei nicht Folge geleistet worden, daher sei die Polizei am 9. Januar 2007 wieder in die Polenzstraße gekommen. Am 11. Januar 2007 habe es dann den Termin bei der Polizei gegeben, den Zschäpe mit André Eminger wahrgenommen habe. Wahrscheinlich habe es ein „persönliches Kennenlernen aus der Not heraus“ zwischen dem 7. Dezember und 12. (phon.) Januar gegeben, so Leibnitz: „Das scheint mir plausibel“. Für eine erste Servicekarte des Fahrradladens „RadMaxx“ habe Zschäpe noch das Alias „Silvia Ro.“ genutzt, danach „Susann Eminger“ wie dann auch bei der Polizei und bei einer Videothek-Mitgliedschaft. Leibnitz: „Da nahm das wohl Fahrt auf, man lernt sich kennen, eine Freundschaft entwickelt sich und Vertrauen.“ Zschäpe habe gewusst, dass sie den Namen nutzen könne. Die Vorsitzende fragt, warum Zschäpe das Alias „Ro.“ nicht mehr genutzt habe. Der Zeuge antwortet: „Silvia Ro. wusste nichts von ihrem Glück, sie hatte mal eine Krankenkassenkarte gegeben“ und habe in Hannover gewohnt. Das Alias „Susann Eminger“ sei wahrscheinlich praktischer gewesen.
Herberger fragt, ob die Ermittlungen gegen Susann Eminger nach Anklageerhebung in München fortgeführt wurden und ob es neue Ansätze gab. Leibnitz: „Anklage in München hieß nicht: Stopp der Ermittlungsverfahren.“ Die BAW habe sich für fünf Personen entschieden, auch wegen Haftsachen, aber die anderen Ermittlungen seien natürlich weitergeführt worden. Irgendwann seien alle offenen Spuren abgearbeitet gewesen. Er würde nicht sagen, dass sie das dann hätten ruhen lassen, so Leibnitz: „Aber zu einem gewissen Zeitpunkt war es auch so, dass man schauen wollte: Was entscheidet das OLG, wie werden Tathandlungen bewertet? Das hat sich in die Länge gezogen.“ Die Rechtskraft des Urteils gegen André Eminger sei auch für das Verfahren gegen Susann Eminger wichtig gewesen, weil es sich um ähnliche Vorwürfe gehandelt habe; da habe man neu bewertet. Das Problem sei der subjektive Tatbestand gewesen: „Was wusste sie zu welchem Zeitpunkt?“ Ihnen sei zugute gekommen, dass Zschäpe sich entschieden habe, beim Bayerischen Untersuchungsausschuss und dann bei weiteren Vernehmungen auszusagen. Ein Teil dieser Aussagen habe Susann Eminger betroffen. Die BAW habe dann entschieden, dass es nun auch im Bereich subjektiver Tatbestand genügend Anhaltspunkte für eine Anklage gebe. Die Vorsitzende sagt, das wolle man erst mal zurückstellen, man wolle sich selbst ein Bild von den Aussagen Zschäpes machen.
Die Vorsitzende Richterin thematisiert dann den Anschlag des NSU am 23. Juni 1999 auf die Pilsbar Sonnenschein in Nürnberg, auf den sie, so Leibnitz, einer der Angeklagten in München gebracht habe. Die BAW habe aber entschieden, die Tat nicht im Münchener Verfahren anzuklagen. Der Anschlag sei zu dem Zeitpunkt 15 Jahre her gewesen, zehn Jahre sei eine „magische Grenze“. Nach der langen Zeit sei es auch mit den Asservaten schwierig gewesen. Die Rohrbombe etwa sei da bereits im „Schulungsbereich“ der Polizei genutzt worden, weswegen man davon keine DNA mehr habe nehmen können. Gefragt, warum der Anschlag von 1999 nicht angeklagt wurde, sagt Leibnitz, man wisse nicht, wie der NSU dorthin gekommen sei, „vielleicht mit der Bahn“. Die Bombe in Form einer Taschenlampe sei im Waschraum der Toilette abgestellt gewesen, der Pächter habe sie beim Reinigen gefunden, drauf gedrückt und so sei die Bombe ausgelöst worden. Man wisse nicht, wann die Bombe abgelegt wurde, wie viel Zeit zwischen den Reinigungszyklen gelegen habe, die Bombe sei ja beim Putzen gefunden worden. Es habe „keine bleibenden und immensen Schäden“ gegeben. Es habe zum Zeitpunkt des Anschlags wenig mediale Berichterstattung gegeben, vielleicht sei die Tat auch deswegen nicht im Bekennervideo.
Die Vorsitzende fragt nach den anderen UnterstützerInnen. Leibnitz sagt, man habe die Ermittlungen recht weit fortgeführt und auch Maßnahmen gegen Verjährung ergriffen, aber die Verfahren seien mittlerweile eingestellt. Offen seien nur noch die Verfahren gegen Susann Eminger und gegen Unbekannt: „Einige Fragen sind offen, aber wir haben durchaus Hoffnung, dass wir Fortschritte machen, wenn Frau Zschäpe mehr kooperiert.“ Er selber habe keinen Kontakt zu Zschäpe, das laufe über die BAW und den Rechtsbeistand.
Herberger fordert den Zeugen auf, die erste Durchsuchung bei den Emingers zu schildern. Leibnitz sagt, man habe aus der TKÜ kurzfristige Erkenntnisse gehabt, dass André Eminger nicht zu Hause sei, sondern mit beiden Kindern zu seinem Bruder nach Mühlenfließ in Brandenburg gereist sei. Man habe einen Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen von Maik Eminger beantragt und die Durchsuchung am 24. November 2011 ab 6:30 Uhr durchgeführt: „Ich hatte das Gefühl, dass man auf uns gewartet hat.“ Niemand habe mehr geschlafen, Maik Eminger sei ihnen schon über den Hof entgegengekommen. Man habe bei der Durchsuchung gesehen, „welchen Geistes Bruder“ auch Maik Eminger sei; er erinnere sich an eine Bank mit Hakenkreuzen. Maik Eminger sei der Polizei schon vorher als Rechtsextremist bekannt gewesen, als einer der vorangehe, organisiere: „Nicht so wie sein Bruder, der eher mitläuft und nichts organisiert.“ Anwesend gewesen seien André Eminger mit Kindern, Maik Eminger und seine Frau sowie deren vier gemeinsame Kinder. André Eminger sei sehr kooperativ und nicht aggressiv gewesen, habe keine Aussage gemacht und die Maßnahmen ruhig über sich ergehen lassen. Es sei eine sehr sachliche Atmosphäre gewesen, das gelte auch für den Bruder Maik. Interessant sei eine Plastiktüte mit 3.835 Euro gewesen, davon 365 Fünf-Euro-Scheine. Man habe immer den Verdacht gehabt, dass das Geld aus Überfällen stammt, habe es aber nicht objektiv belegen können. Leibnitz: „Das Geld gehörte niemanden, ich fragte danach, aber niemand hat sich dazu bekannt.“ Warum sich André und Susann Eminger an unterschiedlichen Orten aufgehalten hätten, erinnere er nicht, so Leibnitz.
Die Vorsitzende fragt nach dem Eindruck des Zeugen zur rechten Gesinnung von André Eminger. Leibnitz antwortet, man sei ja vorbereitet und wisse, mit wem man es zu tun habe. Er habe also durch die Durchsuchung keinen Eindruck gewonnen, den er nicht schon zuvor gehabt habe. Gefragt nach der Angeklagten sagt Leibnitz, er würde sagen, diese sei eingebunden gewesen, auch wenn er das nicht an etwas festmachen könne. Der Zeuge überlegt und sagt dann, es gebe Körperverletzungsdelikte Anfang der 2000er.
Die Vorsitzende fragt nach den Fahrzeuganmietungen. Leibnitz sagt, er habe sich zur Vorbereitung den Vermerk des zuständigen Kollegen Vo. angesehen, der inzwischen verstorben sei. Es gehe um die Zusammenhänge zwischen Fahrzeuganmietungen und Straftaten. Es gebe insgesamt 64 Fahrzeuganmietungen, die man habe ermitteln können, bei vier Unternehmen im Umfeld von Zwickau und Chemnitz. 47 Anmietungen von PKW, 17 Anmietungen von Wohnmobilen. Auf den Namen André Eminger seien dreimal Fahrzeuge angemietet worden, alle stünden in Verbindung mit Straftaten. Es gebe vier Morde ohne bekannte Autoanmietung. Sie würden nun, so Leibnitz, annehmen, dass bei diesen Taten gestohlene Transporter eingesetzt worden seien, denn so habe Zschäpe das ausgesagt. 2004 habe Holger Gerlach Uwe Böhnhardt seinen Führerschein zur Verfügung gestellt, damit habe es neue Möglichkeiten gegeben. Es habe nur eine Urlaubsreise mit einem Wohnmobil gegeben, 2008, da sei Zschäpe nicht dabei gewesen, vielleicht sei das ein Surfurlaub gewesen. Es gebe auch Anmietungen, wo nicht klar ist, wozu diese getätigt worden seien. Die BAW fragt nach den Campingplatzurlauben. Der Zeuge sagt, ab 2008 seien alle Urlaube auf die Angeklagte gebucht worden, auch mit ihrer Anschrift in Zwickau, also müssten dort auch die Unterlagen hingeschickt worden sein. Nach der Enttarnung sei der Urlaub 2012 abgesagt worden. Das sei aus der Familie Eminger heraus erfolgt, er wisse nicht vom wem. Auf Frage zur Kommunikation zwischen Susann Eminger und Beate Zschäpe sagt der Zeuge, es habe viele persönliche Treffen gegeben, man habe gemeinsam Veranstaltungen besucht, zum Beispiel Kulturveranstaltungen oder in einer Bar getroffen. Zschäpe habe ausgesagt, sie hätten überwiegend über Telefonzellen telefoniert. Auf Fragen der Verteidigung antwortet der Zeuge, die gemeinsame Fahrt zur Wohnmobil-Abholung sei schon seit 2011 bekannt gewesen, das habe auf der Auswertung der Handys beruht.
Im Anschluss an die Vernehmung des Zeugen gibt Rechtsanwalt König eine Erklärung ab. Er sagt, es sei die Rede von alten Ermittlungsverfahren gewesen, aber alle wüssten, dass das nicht verwertbar sei Der Bundeszentralregisterauszug seiner Mandantin sei leer. Die Vorsitzende solle in Zukunft vielleicht klarstellen, dass solche Äußerungen weggelassen werden sollten. Herberger entgegnet, es sei nicht als Vorstrafe verwertbar, „aber ich halte es für verwertbar zur Person“. Die BAW regt an, die Verteidigung solle doch bei Bedarf einfach rügen.
Damit endet der Prozesstag.
Von den ersten drei Zeugen zur Krankenkassenkarte im Prozess konnte sich nur einer wirklich an die Ermittlungen vor etwa 13 Jahren erinnern. Das zeigt gleich zu Beginn des Prozesses, welchen Nachteil die späte Anklage hat. Die Rolle von Susann Eminger im NSU-Komplex ist schon lange bekannt. Die Vorsitzende kündigte an, man wolle sich auch das Bekenntnisvideo des NSU im Prozess ansehen und Leibnitz auch zu den einzelnen Taten des NSU befragen. Das Gericht ist also offenbar bereit, nicht nur eng gefasst die Anklage gegen Susann Eminger abzuarbeiten. Darüber hinaus bleiben Fragen: Warum kommt der 2. NSU-Prozess erst jetzt? Warum wurden die anderen Verfahren gegen mögliche UnterstützerInnen eingestellt?
Protokolle und Berichte aus dem ersten NSU-Prozess zur ergänzenden Lektüre
Aussagen des Zeugen Leibnitz:
17. Verhandlungstag – 2. Juli 2013
18. Verhandlungstag – 3. Juli 2013
43. Verhandlungstag – 8. Oktober 2013
160. Verhandlungstag – 18. November 2014
(Text: ck; Redaktion: scs)