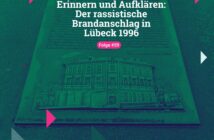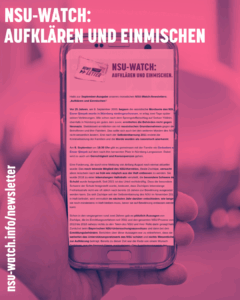 Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.
Wir melden uns einmal im Monat mit unserem Newsletter „Aufklären & Einmischen“ bei euch. Passend zum Titel des Newsletters findet ihr im ersten Teil – Aufklären – Berichte zu unserer Arbeit. Außerdem werfen wir einen Blick auf aktuelle Ereignisse im Themenfeld rechter Terror und seine Aufarbeitung. Im zweiten Teil des Newsletters wird es praktisch: Einmischen. Wir sammeln für euch aktuelle Termine beispielsweise für Veranstaltungen, Kundgebungen und Demonstrationen, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hier könnt ihr euch für den Newsletter anmelden.
Wenn ihr genauer wissen wollt, was euch erwartet, könnt ihr hier die Oktober-Ausgabe des Newsletters in der Webversion nachlesen. (Aus technischen Gründen wird der Newsletter hier grafisch leicht abweichend von der Mail-Version dargestellt.)

Hallo zur Oktober-Ausgabe unseres monatlichen NSU-Watch-Newsletters „Aufklären und Einmischen“!
Während der AfD Rekordergebnisse bei den Landtagswahlen 2026 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern vorausgesagt werden, beschäftigten uns auch in diesem Monat die Verbindungen der Partei zu rechtsterroristischen Strukturen.
Anfang September erhob die Bundesanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Dresden Anklage gegen Mitglieder der sogenannten „Sächsischen Separatisten“, unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die „Sächsischen Separatisten“ sollen der in der extremen Rechten weit verbreiteten Vorstellung eines „Tag X“, an dem Staat und Gesellschaft zusammenbrechen, angehangen haben. Diesen „Tag X“ wollte die Gruppe laut Bundesanwaltschaft nutzen, um „mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen und gegebenenfalls auch in anderen ostdeutschen Ländern erobern, um dort ein am Nationalsozialismus ausgerichtetes Staats- und Gesellschaftswesen zu errichten.“ Dabei sollten unerwünschte Menschengruppen „notfalls durch ethnische Säuberungen aus der Gegend entfernt werden“, so die Bundesanwaltschaft weiter.
Drei der acht, gegen die nun Anklage erhoben wurde, waren auch in der AfD aktiv – zum Beispiel Kurt Hättasch, AfD-Stadtrat in Grimma und bis zu seiner Festnahme Mitarbeiter eines sächsischen AfD-Landtagsabgeordneten. Bei der Festnahme im November 2024 zielte Hättasch mit einer scharfen Waffe auf die Polizei, die daraufhin Warnschüsse abgab. Durch einen der Schüsse wurde Hättasch verletzt. NSU-Watch wird am Prozess gegen die „Sächsischen Separatisten“ dran bleiben.
Die Verbindungen der AfD zu Rechtsterroristen gehen jedoch noch weiter. Seit einiger Zeit werden auch (ehemals) terror- und gewaltaffine Neonazis bei der Partei aktiv und dort mit offenen Armen empfangen.
Einige Beispiele dafür könnt ihr in unserem Beitrag „Rechte Netzwerke in Mecklenburg-Vorpommern im Blick“ zur aktuellen Arbeit des NSU/Rechter Terror-Untersuchungsaussschuss Mecklenburg-Vorpommern in diesem Newsletter nachlesen.
Außerdem im Oktober-Newsletter:
- Wie weiter nach dem Urteil im Prozess zum Brandanschlag von Solingen 2024?
- Wann kommt der Bericht des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex?
Wir erinnern im Oktober an den antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlag von Halle und Wiedersdorf an Yom Kippur 5780 am 19.Oktober 2019. Wir erinnern an Jana L. Auf Wunsch einer Familie nennen wir einen Namen nicht. Beteiligt euch an den Gedenkveranstaltungen in Halle und Berlin!
Weitere Termine findet ihr wie immer am Ende des Newsletters.
Wir erinnern auch an Patrick Thürmer. Patrick, ein 17-jähriger Punk aus Oelsnitz in Sachsen, wurde in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1999 zusammen mit einem Freund in Hohenstein-Ernstthal von drei Neonazis aus einem Kleinbus heraus überfallen. Patrick und sein Freund waren auf dem Heimweg von einem Konzert, das vorher massiv von Neonazis angegriffen worden war. Hört dazu auch unsere Podcast-Folge in Gedenken an Patrick Thürmer aus dem letzten Jahr.
Unser Newsletter ist kostenlos und wird es auch bleiben. Für unsere Arbeit sind wir aber auf eure Unterstützung angewiesen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Spendenseite!
Kein Schlussstrich!
Eure Antifaschist*innen von NSU-Watch

Rechte Netzwerke in Mecklenburg-Vorpommern im Blick
Der NSU/Rechter Terror-Untersuchungsausschuss Mecklenburg-Vorpommern will in seinen wohl letzten Sitzungen das Bild zu rechtem Terror und zu rechten Netzwerken und Behördenhandeln im Nordosten abrunden. Zwischen 2018 und 2024 beleuchtete das Gremium den NSU-Komplex. Im letzten Jahr war das Nordkreuz-Netzwerk Thema, in dem sich unter anderem Polizisten und Soldaten beziehungsweise Reservisten mit der Besorgung von Waffen auf einen „Tag X“ vorbereiteten. Mitglieder fertigten Feindeslisten an und nahmen bei Schießtrainings Bezug auf den Mord an Mehmet Turgut, der 2004 vom NSU erschossen wurde.
Traditionslinien zum NSU-Komplex finden sich auch bei dem im September im Ausschuss thematisierten „Nationalen Sozialisten Rostock/Baltik Korps“. Die „NSR“ waren seit 2008 aktiv, seit etwa 2018 war „Baltik Korps“ der sportliche Arm der Gruppe mit einem Schwerpunkt auf Kampfsport. Die Gruppe war fester Teil des neonazistischen Netzwerks um den „Kampf der Nibelungen“, mindestens ein Mitglied nahm auch bei diesem Wettkampf teil. Auf ihren Social-Media-Plattformen verhöhnte auch diese Gruppe nach der Selbstenttarnung des NSU Mehmet Turgut. Sie bedrohte das Gedenken an ihn, das tatsächlich im Jahr 2012 von mit Eisenstangen bewaffneten Neonazis angegriffen wurde. Nahezu die gesamte Außendarstellung von „Baltik Korps“ war auf Militanz und Einschüchterung ausgerichtet.
Im Juni 2021 wurde die Struktur verboten. Im Untersuchungsausschuss sagten zwei Beamte aus dem Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aus, die das Verbot vorbereitet und umgesetzt hatten. Die Beamten konnten zwar darstellen, dass es nach Prüfung der durch den Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern gesammelten Erkenntnisse juristisch keine Alternative zum Verbot gegeben habe. Die juristische Auseinandersetzung dauere jedoch noch an, weil ein Mitglied gegen das Verbot vorgegangen sei. Allerdings wussten die Zeugen nichts davon, dass der zentrale Telegram-Kanal der Gruppe schlicht umbenannt wurde und ehemalige „NSR/BK“-Mitglieder heute bei der neonazistischen Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ oder der AfD aktiv sind. So war laut antifaschistischer Recherche der sogenannte Kalaschnikow-Mann Ivan K. zwischenzeitlich beim „Baltik Korps“ sowie für die AfD aktiv.
Laut einem der Zeugen war zudem Daniel Fiß eine Führungsperson der NSR. Über einen Umweg bei der Identitären Bewegung ist Fiß laut NDR heute als persönlicher Referent des Fraktionsvorsitzenden der AfD Nikolaus Kramer im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt.
Die Überschneidungen von militant rechten Strukturen zur AfD waren bereits im Nordkreuz-Komplex erkennbar geworden. Mitglieder von „Nordkreuz“, darunter fast die gesamte Führungsstruktur, wiesen Verbindungen in die extrem rechte Partei auf und übernahmen Funktionen und Mandate. Nordkreuzler und AfD-Mitglied Haik Jaeger wurde im September 2025 aus dem Polizeidienst entlassen – nachdem er acht Jahre lang lediglich suspendiert gewesen war und weiter Bezüge erhalten hatte. Er sitzt aktuell für die AfD im Kreistag von Nordwestmecklenburg und versuchte 2025, Bürgermeister von Neukloster zu werden. Zur Wahl durfte er allerdings nicht antreten.
Die beiden am 22. September vom Untersuchungsausschuss angehörten Sachverständigen, Miro Dittrich und Robert Claus, machten klar, dass die Gefahr rechten Terrors in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und international weiter hoch ist. Während sich ‚klassische‘ Strukturen wie Nordkreuz oder „Baltik Korps“ in bekannten Mustern auf den „Tag X“ vorbereiteten, radikalisiere sich parallel eine junge Generation von Neonazis insbesondere in Online-Foren, die dem militanten Akzelerationismus zuzuordnen sind. Ihr Anteil an durchgeführten oder konkret geplanten und durch Behörden aufgedeckten rechten Terrortaten wachse kontinuierlich, so Dittrich.
Adalet heißt Gerechtigkeit. Nach dem Urteil zum Brandanschlag von Solingen 2024
Zwei Monate sind vergangen, seitdem die 5. Große Strafkammer am Landgericht in Wuppertal am 30. Juli 2025 ihr Urteil im Prozess zum Brandanschlag vom 25. März 2024 verkündet hat. In erster Instanz ist der geständige Angeklagte Daniel Sz. dafür zur Verantwortung gezogen worden, in dieser Nacht den Brand vorsätzlich und im Wissen darum, dass sein Handeln Menschen töten könnte, gelegt zu haben. In seiner mündlichen Urteilsbegründung betonte der Vorsitzende Richter Jochen Kötter, dass kein Zweifel daran bestehe, dass der Angeklagte mit der strengst möglichen Strafe zu belegen sei. Auch die besondere Schwere der Schuld sei festzustellen. Folgerichtig müsse auf die lebenslange Haftstrafe auch Sicherheitsverwahrung folgen.
In der Nacht des 25. März 2024 starben vier Menschen: Kancho Emilov Zhilov (30), Katya Todorova Zhilova (29), Galia Kancheva Zhilova (2) und Emily Kancheva Zhilova (4 Monate).
18 Bewohner*innen des Hauses in der Grünewalder Straße in Solingen konnten in höchster Not aus dem brennenden Gebäude entkommen. Drei von ihnen blieb zu ihrer Rettung nur der Sprung aus dem Fenster. Nihat und Ayşe K. entkamen so aus ihrer brenenden Wohnung in der dritten Etage. Nihat K. hielt währenddessen sein Kleinkind im Arm. Nihat und Ayşe K. erlitten schwerste Verletzungen.
Als Motiv für die vorsätzliche und mörderische Brandstiftung hatte der Täter angegeben, wegen Mietschulden im Konflikt mit seiner ehemaligen Vermieterin gewesen zu sein. Denn auch Sz. hatte vor der Tat eine gewisse Zeit in diesem Gebäude gewohnt. Das Urteil folgte diesen Angaben.
Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız, die als Nebenklagevertreterin an der Seite von Ayşe und Nihat K. steht, hatte die Beweismittel, die diese Perspektive auf das Motiv des Täters hätten stützen sollen, immer wieder kritisch unter die Lupe genommen. Dabei fand sie zahlreiche Unterlagen und Spuren, die von der Polizei nicht in die Ermittlungsakte aufgenommen worden waren.
Nur durch ihre Beweisanträge wissen wir, dass im Haus, in dem der Angeklagte zum Zeitpunkt der Brandstiftung wohnte, nationalsozialistische Literatur sowie NS-verherrlichende Bücher und Tonträger gefunden worden waren. Dazu in einer von ihm genutzten Garage ein Poster, auf dem ein rassistisches ‚Gedicht‘ abgebildet war, das schon zu Beginn der 1990er Jahre zur Eskalation rasstistischer Gewaltdiskurse beigetragen hatte.
Başay-Yıldız wies auch auf einen Brand in Wuppertal hin, der im Januar 2022 die Bewohner*innen eines Hauses in der Normannenstraße hätte in Lebensgefahr bringen können. Die Wuppertaler Polizei hatte seinerzeit keine Ermittlungen aufgenommen – obwohl die Spuren schon damals darauf hingewiesen hatten, dass es sich um Brandstiftung handelte. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft auch in diesem Fall gegen Daniel Sz., der sich im Winter 2022 regelmäßig im Haus in der Normannenstraße in der Wohnung seiner Freundin aufhielt. Der Brand fiel mit ihrem Auszug zusammen. Daniel Sz. war zum Tatzeitpunkt vor Ort. In den Wochen zuvor hatte es Briefdiebstähle, Sachbeschädigungen und tätliche Angriffe des Täters gegen einen Bewohner des Hauses gegeben. Dieser Nachbar, der aus Marokko nach Wuppertal gekommen war und zeitweise mit seinen Kindern in der Normannenstraße wohnte, hatte ausgesagt, dass der Angeklagte vor allem ihn aggressiv angegangen habe.
In seiner Urteilsbegründung widmete sich Richter Kötter in höchster Ausführlichkeit der Psyche und psychischen Gesundheit des Täters. Ein politisches Motiv sei, so analysierte Kötter, nicht erkennbar.
Für die Überlebenden und Nebenkläger*innen kann dieses Urteil keinen Rechtsfrieden herstellen. Selbst wenn die Ankernennung des Tatmotivs Rassismus die ohnehin bereits längstmögliche Haftstrafe und Sicherungsverwahrung um keine einzige Minute verlängert hätte, wäre es wichtig gewesen, dass das politische Motiv nicht unter den Teppich gekehrt wird. Leider ist aber das Gegenteil passiert.
In ihrer Stellungnahme vom 1. August 2025 fassen Vertreter*innen der Opferberatung Rheinland, die die Betroffenen begleitet, zusammen, dass und warum der Urteilsspruch den drängenden Fragen der Überlebenden und Angehörigen in keiner Weise gerecht werden kann. Mehr noch: „Wenn ein rechter Mordanschlag zur ‚Stressbewältigung‘ erklärt wird, wenn Täterbiografien mehr Raum erhalten als die Geschichten der Opfer – dann verschiebt sich der Fokus in gefährlicher Weise“, heißt es von der Opferberatung Rheinland.
Das Urteil vom 30. Juli 2025 markiert einen sehr bitteren Moment in der Gegenwart rechter und rassistischer Gewalt. In kaum zu überschätzender Weise stellt es sich gegen eine Beweislast zum politischen Hintergrund der Tat, negiert sie und blendet sie regelrecht als ‚unerheblich‘ aus. Es gibt Lesarten Raum, die rechte Ideologie normalisieren und die Lektüre von Nazi-Literatur als „historisches Interesse“ verharmlosen. Am Ende muss bei dieser Lesart nicht einmal darauf reagiert oder darüber nachgedacht werden, dass und warum der Täter ein zutiefst rassistisches Gedicht besessen hat, mit dem bereits zur Zeit des Brandanschlags von Solingen 1993 gehetzt wurde.
Es wird wichtig bleiben, den Anschlag weiterhin mit Verweis auf genau diese Zusammenhänge einzuordnen und davon zu berichten. Zu zeigen, dass die Gewissheit des Urteils, dass Rassismus keine Rolle gespielt habe, aus guten Gründen in Zweifel steht.
Die Überlebenden und Angehörigen melden sich inzwischen selbst kraftvoll zu Wort. Zusammen mit Angehörigen und Betroffenen rechter Gewalt und ihrer bundesweiten Vernetzung haben sie begonnen, öffentlich von ihrer Geschichte, ihrem Alltag heute und den Folgen des Anschlags zu berichten. Wir unterstützen ihre Anliegen und werden nicht müde werden, unsere Eindrücke aus dem Landgericht Wuppertal mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Zur Unterstützung der Angehörigen und Überlebenden ist die Opferberatung Rheinland ansprechbar.
Gut zu wissen: Aktuelles aus dem Themenbereich Rechter Terror und Antifaschismus
+++ Neukölln-Ausschuss berät über Abschlussbericht +++
Öffentliche Sitzungen des Untersuchungsausschusses zum Neukölln-Komplex im Berliner Abgeordnetenhaus finden nicht mehr statt. Stattdessen berät der Ausschuss nun in nicht-öffentlichen Sitzungen darüber, was in seinem Abschlussbericht stehen soll.
Der Abschlussbericht des Ausschusses muss unter anderem die faktischen Feststellungen zum Untersuchungsgegenstand sowie Schlussfolgerungen und Empfehlungen enthalten. Der Bericht wird danach dem gesamten Plenum des Abgeordnetenhauses zur Entscheidung vorgelegt.
Den Teil zu den Feststellungen entwirft dabei zunächst das (unparteiische) Ausschussbüro. Nach Informationen aus dem Ausschuss liegt den Mitgliedern bereits ein Entwurf für diesen Berichtsteil vor, über den der Ausschuss nun beraten muss. Danach wird es um Schlussfolgerungen und Empfehlungen gehen, also um die politische Bewertung des Behördenhandelns und die aus Sicht des Ausschusses notwendigen Konsequenzen.
Die Bedeutung des faktischen Teils des Berichtes sollte nicht unterschätzt werden. Relevante Ergebnisse der Beweiserhebung sollten dort – also jenseits der immer strittigen poltischen Bewertung – auch tatsächlich benannt und auf diese Weise parlamentarisch festgestellt werden. Zudem müssen die Betroffenen ausreichend Raum im Abschlussbericht bekommen. Ihre Zeug*innenaussagen liegen nun bereits mehrere Jahre zurück und verdienen es, noch einmal angemessen dargestellt zu werden.
Im Anschluss an den gemeinsamen Teil wird es wahrscheinlich mindestens ein sogenanntes Sondervotum aus den Reihen der Opposition geben. In Sondervoten können Fraktionen ihre vom Bericht abweichenden Schlussfolgerungen darstellen. Wann der Bericht im Plenum zur Abstimmung stehen wird, ist noch unklar. Es wird aber vermutlich erst im zweiten Quartal 2026 so weit sein.

Wir Gedenken
Patrick Thürmer
In der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1999 wurde der damals 17-jährige Punk Patrick Thürmer zusammen mit einem Freund in Hohenstein-Ernstthal von drei Neonazis aus einem Kleinbus heraus überfallen. Diese begannen sofort damit, mit Hilfe eines Axtstiels und eines Billardqueues auf Patrick einzuschlagen, so dass dieser am nächsten Vormittag an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Patrick befand sich mit seinem Freund auf dem Heimweg von einem Punk-Konzert, das zuvor im Jugendclub „Off is“ in Hohenstein-Ernstthal stattgefunden hatte. Bereits hier waren Konzertbesucher*innen massiv von Dutzenden Neonazis angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden. Die später anrückende Polizei begnügte sich damit, einen Großteil der anwesenden Punks festzunehmen.
Gemeinsam mit Jan von Bon Courage e.V. haben wir uns im Rahmen einer Podcastfolge anlässlich des 25. Jahrestages des Mordes an Patrick Thürmer im Jahr 2024 auf Spurensuche begeben und sind an die Tatorte gefahren. Jan erzählte von der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1999, von dem Mord an Patrick Thürmer, vom Kampf um das Gedenken und auch darüber, wie er und andere Patrick nicht in Vergessenheit geraten lassen wollen.
🎧 NSU-Watch: Aufklären & Einmischen #105. Der Mord an Patrick Thürmer am 2. Oktober 1999.
Antisemitischer, rassistischer und antifeministischer Anschlag vom 9. Oktober 2019 an Yom Kippur 5780 in Halle und Wiedersdorf
Die Soligruppe 9. Oktober ruft am 9. Oktober zum gemeinsamen Gedenken in Halle/Saale auf:
„Am 09.10. und 364 Tage im Jahr: Räume des Erinnerns schaffen! Kundgebung am 9. Oktober 2025 vor dem TEKİEZ, Ludwig-Wucherer-Straße 12 von 16-18 Uhr.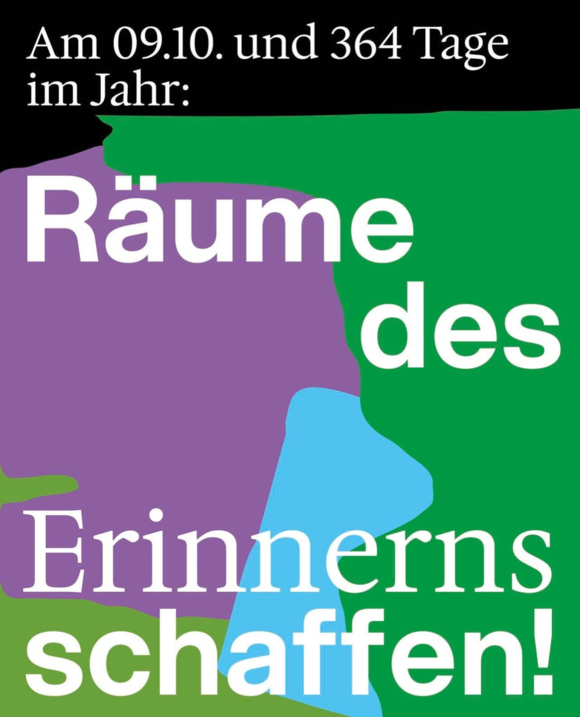
Nach 6 Jahren wollen wir mit euch gemeinsam reflektieren: Wie schaffen wir viele Räume des Erinnerns und können diese er
halten? Wie verhindern wir, dass Gedenken inhaltsleer wird? Wie gelingt es uns, verschiedene Perspektiven einzubinden? Und wie kann Erinnern und Gedenken unabhängig von den Jahrestagen aussehen? Die Folgen des Anschlags beschäftigen uns nicht nur heute, sondern dreihundervierundsechzig Tage im Jahr. Wir laden euch herzlich zur Kundgebung ein, bringt gerne Kerzen, kleine Lichter oder Laternen zum Gedenken mit.“

Am 5. Oktober findet in Berlin die Ceremony of Resilience statt:
„Die Ceremony of Resilience erinnert an den rechtsextremen Anschlag in Halle und Wiedersdorf an Yom Kippur 5780 – am 9. Oktober 2019. Seit sechs Jahren kommen jüdische und andere betroffene Gemeinschaften zusammen, um gemeinsam zu gedenken, sich zu stärken und neue Verbindungen zu knüpfen. Dieses Jahr steht unter dem Thema „Veränderungen“ – denn erstmals wird die Ceremony durch eine interaktive Ausstellung ergänzt. Wir blicken zurück auf sechs Jahre Festival of Resili
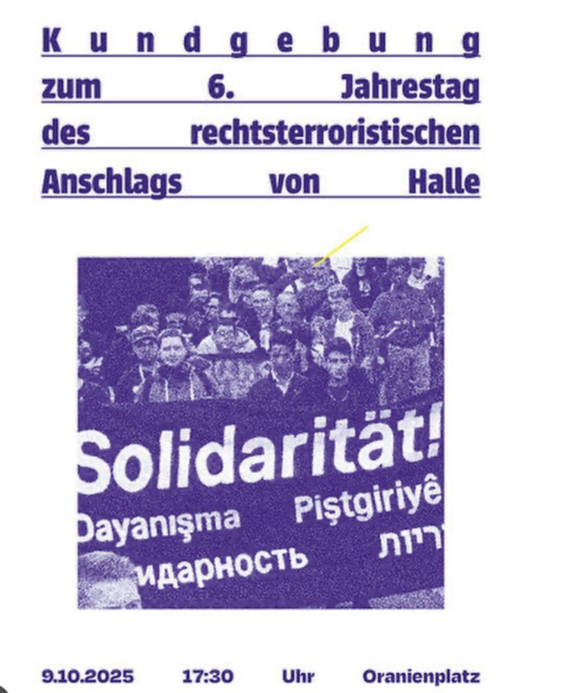
ence: Was hat uns getragen? Was hat uns wütend gemacht? Wie haben wir getrauert? Woher kam unsere Kraft? 🕔 5.
Oktober | 17–20 Uhr | Atelier Gardens, Berlin“
In Berlin organisiert die „Initiative Antisemitismus und Rassismus gemeinsam bekämpfen“ eine Gedenkkundgebung am 9.10.2025 um 17:30 Uhr am Oranienplatz:
„Sechs Jahre danach, am 9. Oktober 2025, möchten wir der Betroffenen gedenken. Wir möchten unsere Solidarität mit ihnen und ihren Angehörigen ausdrücken. Redebeiträge Christina Feist Naomi Henkel-Guembel Paige H. Anastassia Pletoukhina İsmet Tekin (Audiobeitrag) Burak Bektaş Initiative München OEZ erinnern“
+++ Termine +++
2. Oktober, Chemnitz: Wir vergessen nicht! Der Mord an Patrick Thürmer. 18:30 Uhr, Johannisplatz 8. Mehr Infos hier.
2. Oktober, Halle/Saale: Ausstellung: WIR SIND HIER: Die Porträts unseres Lebens. Mit Künstlerin Talya Feldman. 16:00-18:00 Uhr, TEKIEZ. Mehr Infos hier. 2. Oktober, München: rage against abschiebung, das Solifestival 2025. 18 Uhr Feierwerk. Mehr Infos hier.
3. und 4. Oktober, Thüringen: Thüringen stellt sich quer! Gegen vier rechte bis rechtsextreme Veranstaltungen in Thüringen. Mehr Infos hier.
4. Oktober, Wien: Fundis zur Hölle jagen! Den selbsternannten „Lebensschützern“ ihren „Marsch fürs Leben“ vermiesen! Mehr Infos hier.
5. Oktober, Berlin: Ceremony of Resilience. Ceremony of Resilience erinnert an den rechtsextremen Anschlag in Halle und Wiedersdorf an Yom Kippur 5780 – am 9. Oktober 2019. 17:00 Uhr, Atelier Gardens. Mehr Infos hier.
8. Oktober, Chemnitz: CPPD-Festival »Memory Matters« mit dem Schwerpunkt auf „Erinnerung in digitalen Räumen“. Ab 10 Uhr, Johannisplatz 8. Mehr Infos hier.
9. Oktober, Halle (Saale): Am 09.10. und 364 Tage im Jahr: Räume des Erinnerns schaffen! Kundgebung am 9. Oktober 2025 vor dem TEKİEZ, Ludwig-Wucherer-Straße 12 von 16-18 Uhr. Mehr Infos hier.
9. Oktober, Berlin: Gedenkkundgebung zum 6. Jahrestags des Anschlags von Halle. 17:30 bis 19:00, Oranienplatz. Mehr Infos hier.
9. Oktober, Weiden: Robert Höckmayr – Überlebender des Oktoberfestanschlags im Gespräch mit Birgit Mair. Mehr Infos hier.
13. und 27. Oktober, Schwerin: Sitzungen des 2. NSU/Rechter Terror-Untersuchungsausschusses Mecklenburg-Vorpommern. Ab 10 Uhr im Landtag in Schwerin. Weitere Infos hier.
17.-19. Oktober, Marburg: „Euch brennt doch der Hut!“ Der rechten Studentenhistorikertagung entgegentreten. Mehr Infos hier.
18. Oktober, Weiden in der Oberpfalz: Demonstration: Für einen konsequenten Antifaschismus: Nazis keine Ruhe lassen! Mehr Infos hier.
23. Oktober, Weiden: Das Oxner-Attentat 1982 in Nürnberg: Zeitzeugengespräch mit Brigitte Williams im Gespräch mit Birgit Mair. Mehr Infos hier.
23. Oktober, Graz: Podiumsdiskussion: „Steirische Slowen*innen. Die verborgene Minderheit“. Im Rahmen der Ausstellung „Man will uns ans Leben“ | Bomben gegen Minderheiten 1993-1996. 18:00 Uhr, Volkskundemuseum am Paulustor. Mehr Infos hier.
24. Oktober, Berlin: Die NSU-Monologe. Dokumentarisches Theater. 19:00 Uhr, Heimathafen Neukölln. Mehr Infos hier.
25. Oktober, Dortmund: Hoffnung und Solidarität – Stimmen aus dem Solidaritätsnetzwerk Betroffener rechter Gewalt. 19:30 Uhr, Kino/Dortmunder U. Mehr Infos hier.
26. Oktober, Wien: Betroffenheit ohne Betroffene? Zum gesellschaftlichen und medialen Diskurs über rechten Terror. 18:00 Uhr Depot Wien. Mehr Infos hier.
26. Oktober, Graz: Vida Bakondy im Gespräch mit Pater Janisch. Im Rahmen der Ausstellung „Man will uns ans Leben“ | Bomben gegen Minderheiten 1993-1996. Volkskundemuseum am Paulustor. Mehr Infos hier.
Bundesweit im Kino: Film über den rassistischen Anschlag von Hanau, „Das deutsche Volk“. Mehr Infos hier.
Bundesweit im Kino: Film „Die Möllner Briefe“. Mehr Infos hier.
Bis auf Weiteres, Mittwoch-Sonntag, Chemnitz: „Offener Prozess. Ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex“. Johannisplatz 8. Mehr Infos hier.
Bis 26. Oktober, Graz: Austellung „Man will uns ans Leben“ Bomben gegen Minderheiten 1993-1996″. Volkskundemuseum am Paulustor, Gartensaal. Mehr Infos hier.
Bis 21. Dezember, Köln: Ausstellung: 21 JAHRE DANACH – Von der Nagelbombe bis zum Mahnmal. Schanzenstr. 22, 1. Etage. Mehr Infos hier.
Jetzt buchen! Stadtführung: Critical Walk „NSU-Morde in Nürnberg“ der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland e.V. Nürnberg. Preis nach Absprache. Infos und Buchung: isd.nuernberg.buero@isdonline.de. Mehr Infos hier.
Zum Weiterempfehlen und anmelden: nsu-watch.info/newsletter.
(Redaktion und Texte: u.a. ck, scs)